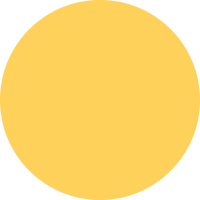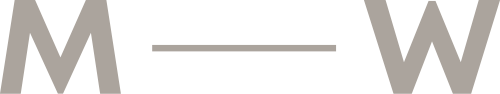Wissen



Zurück zum Anfang: vom Ursprung aus nach Veränderung suchen
Therapien können an einzelnen Symptomen oder spwzifischen Problemen ansetzen und für diese nach kurzfristen Lösungen suchen. Ein nachhaltiger Veränderungprozess beginnt dort, wo die Grundlagen für unsere Lebendigkeit und Verbundenheit mit uns selbst und anderen gelegt werden – im Körper bei der Selbstregulation (Emotions- und Stressregulation).
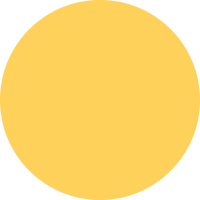
Selbstregulation oder wie wir Mensch werden
Selbstregulation ist eine essenzielle Schutz- und Regenerationsressource. Die Fähigkeit zur Emotions- und Stressregulation (Selbstregulation) entwickelt sich im sicheren Kontakt zwischen Eltern und Kind in den ersten Lebensjahren. Durch Berührung, Zuwendung und liebevolles Eingehen auf unsere Bedürfnisse lernen wir als Baby bzw. Kleinkind, wie wir unsere Emotionen regulieren und wieder in einen ruhigen, ausgeglichenen Zustand zurückfinden, z.B. wenn wir uns ängstigen, aufgeregt, freudig erregt oder erschöpft sind. Ein tiefes Gefühl der Freude, Sicherheit und Verbundenheit mit uns, anderen und der Welt wird so in den ersten Lebensjahren ausgebildet.
Nur wenn wir uns reguliert und sicher fühlen, können wir vertrauensvolle Bindungen eingehen.

Ein gutes Gefühl beginnt im Körper
↓ weiter lesen…


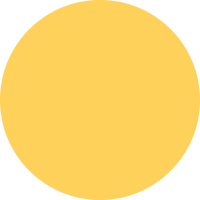
In ständiger Alarmbereitschaft:
Es wird zu viel oder zu wenig gefühlt
Ist die Selbstregulationsfähigkeit beeinträchtigt oder wurde gar nicht erst ausgebildet, gelingt es nach Stress und Anspannung nur schwer, sich selbst wieder in einen angenehmen Zustand zu bringen. Stattdessen hängt man in Übererregung (Zu viel Fühlen: Unruhe, Angst, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Chaos, Drama usw.) oder der Untererregung (Zu wenig Fühlen: Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Leere, reines Funktionieren, Starre usw.) fest oder wechselt übergangslos von dem einen in den anderen Zustand. Manchmal kann es sich anfühlen, als würde man von den Gefühlen unkontrolliert in Besitz genommen. Der Körper signalisiert dann unterschwellig „Gefahr“ und ist in Alarmbereitschaft. Die Umgebung oder andere Menschen werden durch diese Brille der „Bedrohung“ wahrgenommen. Uralte Instinkte von Flucht, Kampf oder Erstarren überlagern dann das rationale, kognitive Handeln. Auch die Bindungsfähigkeit ist dann beispielsweise beeinträchtigt.
Den eigenen Erfahrungen einen Namen geben: Entwicklungs- und Bindungstrauma
↓ weiter lesen
Sich selbst so akzeptieren, wie man ist und tiefe, befriedigende Bindungen eingehen, fällt dann oft schwer. Zurück bleibt oft eine grundlegende Unzufriedenheit mit sich selbst, ein fehlender oder negativer Bezug zum eigenen Körper, eine tiefe Einsamkeit – selbst wenn andere Menschen da sind, ein geringes Vertrauen in andere Menschen sowie ein großes Sicherheitsbedürfnis. Diese Erfahrungen werden als Entwicklungs- und Bindungstrauma bezeichnet. Die körperliche Selbstregulation von Erregungszuständen und Emotionen wird bei einem Entwicklungs- und Bindungstrauma nicht vollständig angelegt oder bei einem Schocktrauma stark beeinträchtigt. Je geringer die Selbstregulationsfähigkeit ausgeprägt ist, desto geringer ist die eigene Resilienz, im weiteren Leben mit widrigen Umständen und Verletzungen umzugehen.
Schon in den ersten Lebensjahren formt sich zudem implizites „Beziehungswissen“. Kann ich bei Stress mit Hilfe rechnen? Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit oder falle ich besser nicht auf? Wie kann ich Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und wieder zur Ruhe kommen? Was fühlt sich gut an? Was ist erlaubt? Wofür muss ich mich schämen? Ist Kontakt angenehm und berechenbar? Ist die Welt ein sicherer Ort? Kinder entwickeln bereits in den ersten Lebensmonaten Erwartungen: Wenn ich das tue, passiert das. Wenn ich weine, nimmt mich meine Mutter auf den Arm und beruhight mich. Wenn ich meine Mutter anschaue, lächelt sie und wir freuen uns gemeinsam usw. Ein Fundus von emotionalen Empfinden verknüpft mit körperlichen Erfahrungen wird so in den ersten Lebensjahren angelegt. Ist die Reaktion der Bezugspersonen meist nicht berechenbar oder nicht auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt, prägt auch dieses implizite Wissen unsere Haltung zu uns selbst, anderen und der Welt nachhaltig.
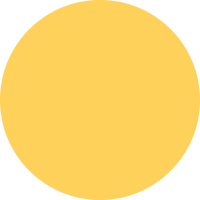
Wie wir unsere Lebendigkeit opfern, damit wir nicht
mehr so verletzbar sind
Psychische Verletzungen hinterlassen körperliche Wunden. Insbesondere bei traumatischen Verletzungen werden Teile des Gehirns beeinträchtigt, die die eigenen Körperempfindungen korrekt wahrnehmen. Schmerz, Leid, Überwältigung wurde am eigenen Körper erfahren und mussten vielfach – völlig alleingelassen damit – bewältigt werden. Je jünger, desto unmöglicher die Aufgabe. Es erscheint dann sicher, nichts im Körper zu fühlen und sich ganz in den Kopf bzw. das Denken zurückzuziehen. Der natürliche Zugang zum eigenen Körper und den eigenen Empfindungen gehen verloren.
Lebendigkeit kannst Du Dir nicht denken, das volle Leben spürst Du nur im Körper.
Mehr Wissen zum Nachlesen findest Du hier
- Detaillierte verständliche Informationen zu Entwicklungs-, Bindungs- und Schocktrauma bei Dami Charf → www.traumaheilung.de
- Neurobiologische Grundlagen und Fachwissen zum Thema Selbstregulation bei Daniel Siegel → www.drdansiegel.com
- Zur Auflösung von Alleinsein und die Stärkung des Zugangs zu natürlichen körperlichen Ressourcen in der Therapie forscht die AEDP-Faculty → http://aedpinstitute.org/publications/articles/
↓ Weitere Verweise
- Die Pionierin der sozialwissenschaftlichen Forschung zum Thema Verletzlichkeit Brené Brown: → www.brenebrown.com
- Fachwissen über traumatische Verletzungen beim Trauma Centre unter der Leitung von Bessel van der Kolk → www.traumacenter.org
- Was macht unser Mensch sein aus → www.einfachmenschsein.com
- Über die Bedeutung von Bindung und den Zugang zu natürlichen körperliche Ressourcen in der Therapie publiziert Diana Fosha → http://aedpinstitute.org/publications/articles/
- Über den biologischen Zusammenhang von Sicherheit und Bindung → http://stephenporges.com
- Mehr Informationen zur natürlichen Regenerationsfähigkeit des Körpers und Resilienz → www.organicintelligence.org