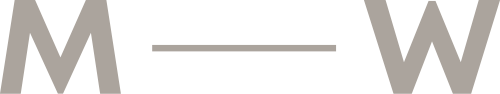Manchmal brauche ich die totale Irritation, um ins Nachdenken zu kommen. Ich rede nicht von einem sachten Hinweis, man könne eine Sache auch anders einschätzen. Ich rede von einer Erschütterung, dem vollen Rums. Das woran ich glaube, fliegt mir um die Ohren und ich stehe ziemlich blank da. Mir geht es dabei gar nicht so sehr darum, ob es objektiv eine große Sache ist. Mein Maßstab ist: Betrifft es mich! Stellt mich etwas grundlegend in Frage! Das passiert nicht oft – zum Glück – was dann folgt, ist dann ziemlich anstrengend. Es entsteht eine freie Fläche, die nicht beschrieben ist. Ich stehe da, ohne vorgefertigte Meinungen, Annahmen, tiefe Überzeugungen und Erfahrungsschätze, die mich sonst wie ein wärmender, schützender Mantel umgeben.
Das ist mir passiert, als ich vor vielen Jahren auf den TED-Talk von Brené Brown: https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=de#t-24712 gestoßen bin. Mittlerweile ist sie durch ihre Bücher auch außerhalb interessierter Kreise ziemlich bekannt, damals war sie es noch nicht.
Brené Brown forscht über Verletzlichkeit
Brené Brown ist Sozialwissenschaftlerin, so wie ich. Ihr Leben kreist um universitäre Forschung, Daten, Empirie und Messbarkeit. Für sie, wie für viele Wissenschaftler, gilt: Es ist etwas wahr und richtig, wenn es empirisch sauber erhoben und kategorisiert ist. So wird die Welt handhabbar und kontrollierbar. Damit kommt man ziemlich gut durchs Leben. Von ungefähr da, komme auch ich her. In ihrem Vortrag erzählt sie über ihr Forschungsprojekt mit tausenden von Studienteilnehmern zur Erforschung von Liebe und Verbundenheit und dem Gegenteil davon, der Scham, also dem Gefühl nicht dazu zugehören. Sie erzählt davon, wie ihre Forschungsergebnisse sie ins Zweifeln gebracht haben, da sie mit wissenschaftlichen Methoden, denen sie vertraut und auf denen ihre Profession basiert, zu völlig unerwarteten Ergebnissen kommt, die nicht in ihr Weltbild passen.
Bin ich okay so wie ich bin? Glaube ich das wirklich?
Ihre sozialwissenschaftliche Arbeit zeigt, dass die Menschen, die sich zugehörig und verbunden fühlen, glauben, dass sie es wert sind, geliebt zu werden und dazu zu gehören. Bei denen, die mit Liebe und Zugehörigkeit kämpfen, überwiegt die Scham: „Irgendetwas ist an mir, wenn es die anderen von mir sehen oder wissen, erkennen sie, dass ich der Verbindung nicht wert bin.“ Dahinter steht der Grundgedanke: „Ich bin nicht genug“ – nicht schlau genug, nicht schön genug, nicht dünn genug, nicht erfolgreich genug oder was auch immer. Unser gefühltes „nicht genug sein“ verstecken wir im Alltag ziemlich gut und entwickeln allerlei Strategien, um unser Manko vor anderen zu verbergen: z.B. durch Perfektionismus und Kontrolle. Eine wirkliche Verbindung zu einem Menschen oder etwas, das uns wichtig im Leben ist, kann jedoch nur gelingen, wenn wir uns engagieren, mit allen was wir zu geben in der Lage sind. Nur mit offenen Visier können wir mit unserer Umwelt in echten Kontakt treten. Am Ende läuft es darauf hinaus: sich zu trauen, sich zu zeigen, so wie man ist und zuzulassen, wirklich gesehen zu werden – mit allen Stärken und Schwächen.
Kann ich vertrauen und mit Unsicherheit umgehen?
Es geht z.B. darum, zuerst „Ich liebe Dich zu sagen“ bevor es der andere sagt, für etwas einzutreten, obwohl man nicht weiß, wie es enden wird oder ob andere dabei unterstützen werden. Das ist verdammt mutig. Es geht um einen Vertrauensvorschuss, ohne Garantie auf ein Happy End. Sich exponieren, sich ehrlich machen und den ersten Schritt ins Ungewisse wagen. Sich entblößen, authentisch sein, auch wenn dann alle anderen die eigene Unperfektion sehen. Mensch sein, eben. Nähe, Liebe, Verbundenheit und Freude sind der Lohn. Verletzlichkeit ist der Preis. Verletzlich sein fühlt sich nicht immer gut an, aber das eine funktioniert nicht ohne das andere. Verletzlichkeit erfordert Mut. Verletzlichkeit ist keine Schwäche. Verletzlichkeit macht stark. Das ist die Quintessenz von Brené Browns Forschungsarbeit.
Will ich wirklich verletzlich sein?
Alles in mir schreit: Natürlich ist Verletzlichkeit Schwäche. Wenn ich mir die Blöße gebe, mich angreifbar mache, wird das jemand ausnutzen und genau in diese Wunde stoßen. Auf der Arbeit zuzugeben, etwas nicht zu können oder einen Fehler gemacht zu haben. Einer Freundin seine tiefsten Ängste zu gestehen. Ne, nicht wirklich!
Warum trifft mich das so?
Wäre Brené Brown eine Esoterikerin in wallenden Gewändern – geschenkt. Wäre sie eine Therapeutin, die von Verletzlichkeit redet – wären ihre Worte vielleicht schnell wieder verpufft. Ihre Worte haben in mir einen Nachhall erzeugt, weil ich mich in ihr wiedererkenne und sie mich mit meinen eigenen Waffen schlägt: mit sozialwissenschaftlicher Forschung. Das ist meine Heimat. Da bin ich zu Hause. Ich kann so gut nachvollziehen, wie sie Ihr Erschrecken über ihre Ergebnisse beschreibt: Wer will schon verletzlich sein. Das ist völlig inakzeptabel.
Ich bin besonders verletzbar, wenn ich mein Herz an etwas verschenke
Rums. Ich stehe also auf der freien Fläche, die nicht beschrieben ist. In diesem Raum werden mir eigene Erfahrungen viel bewusster und erscheinen plötzlich in einem etwas anderen Licht. Auch ich fühle mich manchmal verletzlich. Ich fühle mich verletzlich, wenn mir wirklich etwas bedeutet. Ich mein Herz reinhänge. Wenn ich abends, bevor ich ins Bett gebe, noch mal nach meinen schlafenden Kindern sehe, fühle ich einen großen Frieden und mich gleichzeitig unheimlich verletzlich. Der Gedanke, dass ihnen etwas zustoßen könnte, ist für mich unerträglich.
Ich weiß aus eigener Erfahrung um diese Unerträglichkeit und habe durch mein Ehrenamt mit vielen trauernden Eltern gesprochen. Egal wo man in der Trauer steht, ob da der Wunsch ist, seinem Kind in den Tod zu folgen, es dunkel und hoffnungslos ist oder ein Leben wieder vorstellbar wird, jetzt ein bewussteres Leben führt, ist da immer die Freude über das Kind, über die gemeinsam verbrachte Zeit. Der Gedanke: „Hätte ich doch nur kein Kind gehabt“ oder „Hätte ich doch nur meinen Sohn/meine Tochter weniger geliebt“ ist den meisten Trauernden fremd. Es tut so weh, gerade weil man geliebt und alles gegeben hat. Der Preis ist hoch. Aber für mich wäre der Preis nicht zu lieben, wesentlich höher. Ich weiß das für mich, ich kann das mit voller Überzeugung sagen.
Wie geht bloß der Alltagstransfer?
Ich gestehe mir ein, dass mir das Ganze doch nicht so fremd ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Was in „Extremsituationen“ wahr ist, verliert doch nicht im schnöden Alltag an Gültigkeit, oder etwas doch? Wenn im weiteren Umfeld etwas Schlimmes passiert, sagen wir ein junger Familienvater einen Schlaganfall hat, dann nehmen wir uns vor bewusster zu leben, dankbarer für das zu sein was man hat. Und nach ein paar Tagen gerät dieses Wissen in den Hintergrund und der Alltagstrott sagt wieder „Hallo“. Es ist so ähnlich aber doch etwas anders. Es ist wie ein Splitt. Das eine ist wahr und gleichzeitig gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten und Wahrheiten, die mich durch den Alltag leiten, die die Leitplanken für mein Handeln vorgeben: Da sind all die Gedanken von Verletzlichkeit in meinem Kopf, die Hilflosigkeit und Schwäche damit assoziieren. Da traue ich mich nicht, im Alltag mit Freunden, Nachbarn und Kollegen authentisch zu zeigen. Warum mache ich diese Abstufung? Warum laufe ich mit angezogener Handbremse durch meinen Alltag? Involviere mich nie ganz, um nicht enttäuscht zu werden. Notfalls kann ich mich damit trösten, wenn ich es nur wirklich versucht hätte, dann, ja dann…. . Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir ganz schön erfinderisch werden, um uns ja nicht mit der eigenen Verletzlichkeit, der Angst vor der Bloßstellung, der Zurückweisung oder des Scheiterns zu konfrontieren. Verletzlichkeit zulassen, bedeutet immer auch, sich der Unsicherheit zu stellen. Wir wissen nicht, wie unser Umfeld auf unsere Initiative reagieren wird. Man selbst hat alles gegeben, der Rest liegt nicht mehr in der eigenen Hand. „Hilflos“, „ausgeliefert sein“, „Kontrollverlust“ schießen mir dann durch den Kopf. Dann wird es richtig unangenehm.
Mut zur radikalen Ehrlichkeit mit sich selbst
Betitele ich es anders mit „Freiraum“ oder „Möglichkeitsraum“ wirkt das, was dann entsteht, nicht mehr ganz so fürchterlich. Es ist mehr als Augenwischerei. Die Chance wird sichtbarer. Im freien Raum gibt es keine Kleidungsschicht mehr, hinter die wir unsere eigene Verletzlichkeit packen können. Manchmal braucht es Ehrlichkeit mit sich selbst: Ich traue mich nicht mich wirklich für jemanden oder etwas zu engagieren. Es ist letztendlich immer der gleiche Abwägungsprozess: Engagement und Verbundenheit auf der einen Seite und die Verletzlichkeit auf der anderen, egal worum es geht.
Diese Erkenntnis hat mich vor vielen Jahren in Bewegung gebracht: in dem freien Raum sind mit der Zeit neue Erfahrungen und Überzeugungen gereift, die mein Alltag heute bereichern. Letztendlich haben diese Erfahrungen und Überlegungen mich zur Psychotherapie und zu meiner eigenen Praxis geführt.
Brené Brown ist mittlerweile durch ihre Bücher und ihre tollen Vorträge auch in Deutschland viel bekannter geworden. Sie steht für ihre Erkenntnisse rund um Verletzlichkeit, Scham, Hilflosigkeit und Scheitern – seien sie auch noch so sperrig. Ihr „Der Mann in der Arena“-Zitat aus Rede des früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt „Citizenship in a Republic“ 1910 beschreibt ziemlich gut, worum es geht:
„Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist; dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut; der sich tapfer bemüht; der irrt und wieder und wieder scheitert; der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe, und sich an einer würdigen Sache verausgabt; der, im besten Fall, am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt; und der, im schlechtesten Fall des Scheiterns, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat.“
Trau Dich – auch.